"Was soll ich tun?"
Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Dann muss ich zuerst für mich herausfinden, ob das eine Aufgabe oder ein neuartiges Problem ist:
Aufgaben zeichnen sich meist dadurch aus, dass es Lösungen gibt. Das Gespräch ist dann recht schnell beendet: Bei der Erfüllung von Aufgaben kann und sollte ich nicht tätig werden, es ist in der Regel bereits alles vorhanden oder kann beschafft werden.
Neuartige Probleme zeichnen sich meist dadurch aus, dass es trotz mehrerer Anläufe noch keine Lösung gibt und auch niemand bekannt ist, der das Problem lösen kann (denn dann wäre es eine Aufgabe).
Dann gibt es nur noch eine letzte Hürde zu meistern (grobe Daumenregel):
Ist es direkt analysierbar, planbar, reparierbar? Dann ist es vermutlich ein kompliziertes, aber eben direkt lösbares Problem. Man braucht mich hier nicht.
Verändert es sich, wenn man es beobachtet und beeinflusst, aber niemand weiß so recht, wie und weshalb? Dann haben wir vermutlich ein komplexes System, das ein dysfunktionales Verhalten zeigt.
Wenn das der Fall ist, rieselt ein Glücksgefühl durch meinen Körper:
Jetzt haben wir ein echtes, neuartiges Problem!
Trivialisierung
In komplexen Situationen greifen trivialisierende Lösungsfragen wie "Was soll ich machen?" oder "Was ist die richtige Lösung?" zu kurz. Sie suggerieren eine monokausale, eindeutig entscheidbare Lösung und blenden damit wesentliche Merkmale von Komplexität aus:
- Z.B. die Vielzahl vernetzter Einflussfaktoren mit schwer durchschaubaren Ursache-Wirkungs-Beziehungen,
- die allgegenwärtigen Unsicherheiten bei unvorhersehbaren Entwicklungen
- sowie mögliche unbeabsichtigte Konsequenzen unseres Handelns.
In der Praxis erlebt man es meist sehr schnell (und oft mit einer saftigen Watschn), dass simple Patentrezepte für komplexe Probleme gar nicht existieren können.
Die Welt ist vielmehr voll von Ambiguität, ambivalent, widersprüchlich / paradox und keine Handlung bleibt ohne potenzielle Nebenwirkungen. Nichts geschieht isoliert; jede Intervention erzeugt im System weitere Welleneffekte, und je komplexer das System, desto unvorhersehbarer, zahlreicher und vieldimensionaler sind die unbeabsichtigten Konsequenzen.
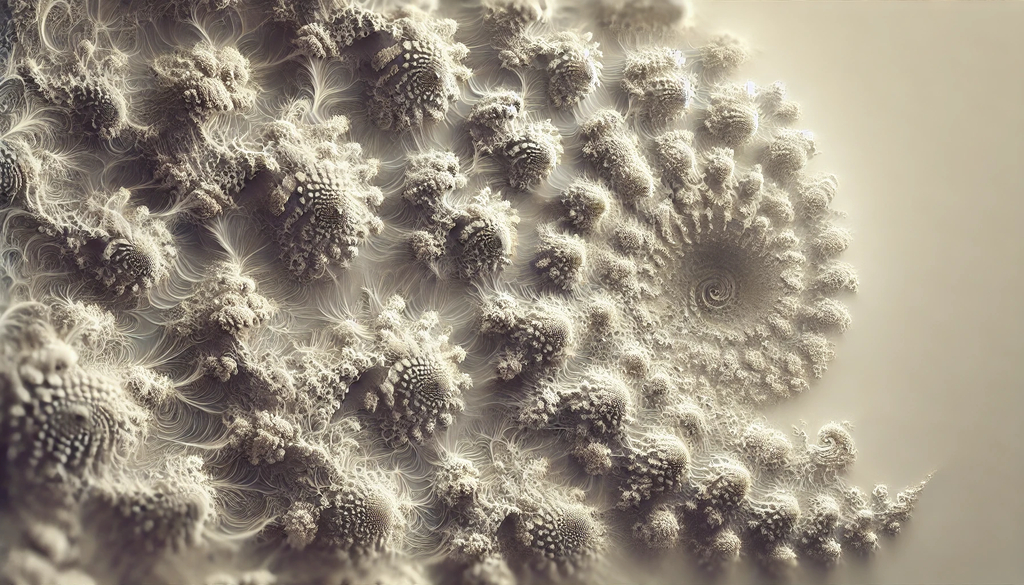
Ein immer anderer Blick auf alles und die Welt.
Ich arbeite bevorzugt mit Ebenen-Modellen Das sind (lange) Listen mit unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema. Einen kleinen Einblick findest Du hier in diesem TEDx Vortrag, aber das ist gerade gar nicht so wichtig.
Wenn ich ein echtes Problem in einer komplexen Situation beobachte, nehme ich ein paar Notizbücher zur Hand und gehe systematisch zuerst durch viele Perspektiven und bilde daraus im jeweiligen Kontext erste Fragen.
Das ist zum einen Teil ein systematisch-schematischer Akt, zum anderen Teil ein hochgradig intuitiver Prozess.
Hier findest Du eine Auswahl der Perspektiven, die ich einnehme, um Sachverhalte zu verstehen (bitte beachten: Das hier ist alles generalisiert; in der Praxis arbeite ich mit kontextbezogenen Perspektiven.)
- Ein systemischer Blick auf die Beziehungen und Wechselwirkungen.
- Die kybernetische Perspektive auf die Steuerung, Regelkreise, Feedback & Co.
- Wenn vernachlässigt, dann langfristig teuer: Der ethische Standpunkt.
- Eine psychologische Sichtweise auf menschliche Faktoren.
- Die strategische Perspektive auf Ziele, Kontexte, Prämissen, Ressourcen, Risiken.
- Das Narrativ: Die Geschichten, Bilder, Rituale im System.
- Machtbezogene/ politische Perspektive mit Fokus auf Verbindungen, Einfluss, Kräfte.
- Die ökologische Position mit Bezug zur Umwelt und Ökosystemen.
- Hier wird's Meta: Die Reflexive Perspektive.
Es gibt noch deutlich mehr Perspektiven in den Notizbüchern, aber mit irgendwas muss ich ja mal anfangen. Bei positiver Resonanz füge ich gerne weitere Auszüge dazu.
Systemische Perspektiven
Bei der systemischen Perspektive betrachte ich ein neues Problem als Teil eines größeren Ganzen.
Im Gespräch geht es dann um Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen den Elementen eines Systems, um Muster, Strukturen und Rückkopplungen zu verstehen, die das Problem beeinflussen.
Statt isoliert nach einer Lösung zu suchen ("Was soll ich tun?), frage ich mein Gegenüber, wie sich das Gesamtsystem verhält, und dann beobachten wir es beide.
Während wir es beobachten, entwickle ich aus meinen Ebenen-Modellen z. B. solche Fragestellungen:
- Welche Verbindungen von Elementen, Entitäten und Akteuren gehören zum System und wie beeinflussen sie einander wechselseitig?
- Wo zeigen sich Rückkopplungsschleifen, die die Dynamik der Situation verstärken oder abschwächen?
- Welche Attraktoren/ Repelloren halten das System stabil?
- Wie hat sich das System im Laufe der Zeit entwickelt, und welche wiederkehrenden Muster sind erkennbar?
- Wo liegen die Grenzen des Systems, und welche externen Faktoren wirken von außen auf die Situation ein?
- Welche Annahmen über das System (z. B. Rollen, Regeln, Erwartungen) könnten das Problem aufrechterhalten?
- Welche unbeabsichtigten Folgen haben frühere Eingriffe in das System gehabt, und was lernen wir daraus für zukünftige Maßnahmen?
- An welchen Hebelpunkten im System könnte eine Veränderung die größte Wirkung entfalten?
- Wie könnten Änderungen in einem Teil des Systems (z. B. in Prozessen oder Beziehungen) andere Teile beeinflussen?
- Welche Systemstrukturen (etwa Hierarchien, Kommunikationswege oder informelle Netzwerke) tragen zum Problem bei oder verhindern Lösungen? (Vorsicht ...)
Solche systemischen Perspektiven helfen mir, das Problem im Gesamtzusammenhang feiner differenziert zu beobachten und zu be-greifen.
Ich brauche diese Sichtbarmachung von Wechselwirkungen und Strukturen, damit ich absichtsvollere Impulse in das System hineingeben -es stören, irritieren- kann.
Falls Du mit bestimmten Fragestellungen besonders gerne arbeitest: Schick mir bitte eine E-Mail, ich füge diese hier gerne dazu, selbstverständlich mit vollständiger Referenz!
Die kybernetische Sicht
Im Rahmen der kybernetischen Perspektive denke ich vor allem in Regelkreisen, Feedback-Schleifen und kontinuierlichen Anpassungen.
Im Gespräch schaue ich mir an, wie ein System auf Störungen und Veränderungen reagiert und wie es sich permanent selbst regulieren oder neue Gleichgewichte finden kann; oder auch, wie sich bestimmte Muster sich immer und immer wiederholen, sich re-inszenieren.
Ich höre zu, welche Beobachtungen nach z. B. kleinen (Probe-)Impulsen gemacht wurden, welche Rückmeldungen es gab und wie wir anhand dieser Feedbacks unsere Vorgehensweise iterativ anpassen können.
Aus meinen Ebenen-Modellen leite ich dann unter anderem die nachstehenden Fragestellungen ab; vielleicht sind ja Impulse für Dich dabei?
- Welche Rückkopplungsschleifen sind im System am Werk, und wie verstärken oder dämpfen diese Schleifen aktuelle Entwicklungen?
- Wie rasch reagiert das System auf Eingriffe (z. B. Veränderungen an Parametern, Kommunikation, Strukturen)? Und welche Verzögerungen sind typisch?
- Welche Regelgrößen/ Metriken können gemessen oder beobachtet werden, um den Systemzustand kontinuierlich zu prüfen?
- Was passiert, wenn wir nur kleine Impulse setzen und dann genau hinschauen, wie das System sich anpasst? (Pilotideen ...)
- Wie gehen wir mit Spannungen um, die beim "Nachjustieren" auftreten? Wie kann das System auf neue "Sollwerte" eingeschwungen werden?
- Welche alternativen Szenarien des Systemverhaltens (Best/Worst/Average) sollten wir durchdenken, um vorbereitet zu sein?
- Wo könnte das System kippen bzw. wann wird aus einer scheinbar stabilen Lage eine dynamische, unkontrollierte Veränderung?
- Wie lassen sich in diesem Rahmen Regelkreise bewusster gestalten, sodass sie nicht zufällig oder ungewollt ablaufen?
- Welche Informationsflüsse sind essenziell, damit das System "lernt", sich anzupassen und Ungleichgewichte zu korrigieren?
- Wie schaffen wir Freiräume für spontane, adaptive Antworten des Systems, statt alles starr durchplanen zu wollen? (Spoiler: In Deutschland manchmal eine echte Herausforderung ... ;-) ).
Die kybernetische Perspektive hilft mir, Dynamik und Steuerung nicht als starre Vorgabe, sondern als fortlaufenden Balanceakt zu begreifen. Wichtig: Dafür braucht es auch ein Gegenüber, mit dem das möglich ist. Ich frage regelmäßig Menschen, ob Sie den Mut haben möchten, sich auf so etwas einzulassen. Das wird oft bejaht, und meist kommt nach einigen Sessions die Aussage: "Jetzt verstehe ich, was Du damals mit MUT gemeint hast!".
Ich bleibe in ständigem Austausch mit den Beteiligten, um Feedback und Daten zu erhalten und damit unsere Aktionen iterativ zu justieren. So kann sich in komplexen Systemen ein stabiler Fluss aus Beobachten, Entstehen lassen/Impulse setzen, Verstehen/Lernen, Beobachten ... entwickeln.
Hast Du weitere Fragen oder spannende Beispiele zum kybernetischen Ansatz? Ich freue mich auf Deine E-Mail – gerne ergänze ich hier Deine Anregungen inkl. Credits, versteht sich!
Die ethische Sicht
Bei der ethischen Perspektive geht es mir um Werte und Verantwortung. Dabei geht es um die Interessen und Rechte aller Beteiligten (und Betroffenen), auch derer, die vielleicht nicht sichtbar oder gar nicht anwesend sind. Ganz wichtig: Es geht nicht nur um das "richtig" oder "falsch", sondern um vielfältige Grautöne, die wir im konkreten Kontext aushandeln.
Wenn ich diese Sicht einnehme, frage ich meist, wer alles ein legitimes Interesse hat, wie gerecht oder ungerecht es zugeht und ob sich Folgekosten und Risiken fair verteilen. Das kann schnell kompliziert werden, aber mir ist es wichtiger, dass wir nicht unbedacht Menschen "unter den Tisch fallen lassen".
Aus meinen Ebenen-Modellen leite ich dann zum Beispiel folgende Fragestellungen ab:
- Welche Werte (Gerechtigkeit, Freiheit, Fürsorge etc.) sind hier relevant und wie schlagen sie sich konkret nieder?
- Wer hat etwas zu verlieren, wenn wir die Situation verändern? Wer profitiert davon? (Oft erkennbar an niedriger Latenz des Widerstands ...)
- Wie können wir sicherstellen, dass Rechte und Bedürfnisse aller Beteiligten angemessen berücksichtigt werden?
- Welche intergenerationalen Effekte (z. B. nächste Generation, Ressourcenverbrauch) entstehen aus unseren Entscheidungen?
- Gibt es kritische Interessenkonflikte (z. B. ökonomische vs. soziale Interessen) und wie gehen wir damit um?
- Welche Verantwortung haben wir gegenüber denjenigen, die kaum mitreden können (z. B. Kinder, Tiere, Umwelt)?
- Wie können wir Entscheidungen so dokumentieren, dass sie nachvollziehbar und transparent bleiben?
- Was würde der "Worst Case" bedeuten, wenn wir ethische Gesichtspunkte ignorieren?
- Welche moralischen Dilemmata tauchen auf und wie kann man gemeinsam darüber sprechen, ohne vorschnell zu urteilen?
- Inwieweit tragen wir dafür Sorge, dass Betroffene nicht nur "Objekte" von Entscheidungen sind, sondern aktiv einbezogen werden?
Ich habe oft erlebt, dass diese ethischen Fragen nicht den schnellen Output bringen, aber sie verhindern viel Schaden. Sie schaffen Vertrauen und tragen dazu bei, dass das "Warum" hinter einer Entscheidung greifbarer wird. Und wenn Konflikte auftreten, können wir uns auf eine ethische Grundlage beziehen, statt auf persönliche Empfindlichkeiten.
Hast Du weitere Ideen oder kritische Einwände, wie man Ethik noch stärker in Entscheidungen einbinden kann? Schreib mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich, wenn wir diese Frageliste noch facettenreicher gestalten!
Die psychologische Sicht
Im Rahmen der psychologischen Perspektive nehme ich die beteiligten Menschen in den Fokus. Es geht mir um innere Dynamiken, individuelle Muster, Bedürfnisse, Ängste, Rollen, Konflikte: All das, was mitläuft, mitschwingt oder unterschwellig wirkt.
Diese Sichtweise ist für mich besonders dann hilfreich, wenn Entscheidungen blockiert sind, Kommunikation hakt oder der Eindruck entsteht, dass "eigentlich alles da ist", aber trotzdem nichts weitergeht.
Dann gilt es, fein(fühlig) hinzuhören: Was wird gesagt und was nicht? Wie sprechen Menschen über sich und die Situation? Und welche Beweggründe, Prägungen oder Schutzmechanismen könnten hinter bestimmten Haltungen stecken?
Da viele Menschen in meinem Umfeld therapeutisch arbeiten, gehört dieses Ebenen-Modell zu einem meiner umfangreichsten Sammlungen. Hier sind ein paar Fragestellungen, die ich daraus ableite:
- Welche inneren Antreiber (z. B. Perfektionismus, Harmoniebedürfnis, Kontrollwille) prägen das Verhalten in dieser Situation?
- Welche Ängste (z. B. vor Ablehnung, Kontrollverlust, Scheitern) könnten die Bereitschaft zur Veränderung beeinflussen?
- Gibt es wiederkehrende emotionale Muster (z. B. Rückzug, Trotz, Überanpassung), die Entscheidungsprozesse blockieren?
- Welche ungesagten Loyalitäten (z. B. gegenüber früheren Führungskräften, Eltern, Wertesystemen) könnten wirken? In diesem Kontext extrem interessant: Ist das System an Loyalität oder Prinzipen ausgerichtet?
- Wie gehen die Beteiligten mit Ambivalenz um?
- Welche psychologischen Rollen (z. B. Retter, Opfer, Täter, Rebellen) werden im System eingenommen und was halten sie stabil?
- Wie stark ist der Einfluss von Selbstbild und Fremdbild auf Kommunikation, Verhalten und Erwartungen?
- Welche unausgesprochenen Konflikte oder Tabus schwelen im Hintergrund und erschweren offene Klärung? (Tipp: Auch als Nichtraucher einfach mal für 10 Minuten in die Raucherecke stellen ...)
- Was brauchen einzelne Personen emotional, um handlungsfähig zu werden? (z. B. Sicherheit, Vertrauen, Resonanz)
- Gibt es alte Verletzungen oder Erfahrungen, die aktuell reaktiviert werden, obwohl sie mit dem aktuellen Thema nur indirekt zu tun haben?
Ich erlebe regelmäßig, wie tief menschliche Dynamiken Entscheidungen und Prozesse beeinflussen, selbst in scheinbar rationalen Kontexten. Wenn wir diesen Faktoren den Raum geben, den sie tatsächlich brauchen, werden Konflikte besprechbar, Haltungen verständlicher und Veränderung oft erst möglich. Ich weiß, dass das oft sehr schwierig ist. Dazu kommt noch, dass ich ausschließlich beratend/ coachend und auf keinen Fall therapeutisch tätig bin. Die Abgrenzung ist manchmal etwas herausfordernd und ich weiß, dass ich an dieser Stelle noch unendlich viel dazulernen muss und möchte. Dennoch ist diese menschliche Perspektive so wichtig, wertvoll und relevant, dass sie zu einer ganzheitlichen Betrachtung dazu gehört.
Hast Du psychologische Fragen oder Gedanken, die Dir helfen, komplexe Situationen besser zu verstehen? Dann schick mir gerne eine E-Mail – ich nehme sie gerne auf, natürlich mit Referenz.
Die strategische Sicht
Bei der strategischen Perspektive schaue ich bei der Analyse echter Probleme auf Ziele, Spannungsfelder, Ressourcen, Zeiträume. Dazu gehört oft, zu differenzieren: Was ist überhaupt/ eigentlich gewollt? Wer will was, wozu, warum gerade jetzt und was könnte daraus entstehen?
Es geht mir nicht darum, irgendwas strategisch "durchzuziehen", sondern Orientierung zu schaffen. Freiheitsgrade entstehen zu lassen oder zu erarbeiten. Zielkonflikte sichtbar zu machen. Und daraus gemeinsam Handlungsräume zu entwickeln.
Diese Sicht ist hilfreich, wenn Menschen sagen "Ich weiß nicht, was ich will" oder "Ich weiß nicht, ob das richtig ist". Oft ist nicht das Ziel unklar, sondern die Bewertungskriterien. Oder es fehlen Zeitachsen, um eine Entscheidung einzuordnen. Oder es fehlen Kontexte, in denen sich etwas überhaupt sinnvoll entscheiden lässt.
(Notiz an mich: Hier einen Link zur Entscheidungs-Matrix Level 1-5 einfügen. Bis dahin kann für den rationalen Anteil multi-faktorieller/ multi-dimensionaler Entscheidungen dieses Werkzeug verwendet werden.)
Hier ein paar strategische Fragen aus meinen Ebenen-Modellen, die mir helfen, tiefer zu denken:
- Was ist das übergeordnete Zielbild und ist es überhaupt ein Ziel oder ein Zustand?
- Gibt es Teilziele, die zeitlich oder logisch vorgelagert sind?
- Welche Spannungsfelder (z. B. Sicherheit vs. Flexibilität) prägen diese Situation?
- Welche Ressourcen stehen zur Verfügung und sind das wirklich Ressourcen oder nur Annahmen? (Tipp: Wenn Startup, dann oft Annahmen ...)
- Was passiert, wenn wir nichts tun oder zu früh, zu viel, zu schnell?
- Welche kritischen Pfade oder Abhängigkeiten gibt es, die wir kennen sollten?
- Wie sieht der Zeithorizont aus kurzfristig, mittelfristig, langfristig?
- Wer sind die Stakeholder und welche unterschiedlichen Landkarten benutzen sie?
- Was sind entscheidbare Aspekte und was ist eher zu beobachten, zu begleiten oder zu moderieren?
- Welche Szenarien ergeben sich aus den verschiedenen Optionen und wie robust sind diese gegenüber äußeren Einflüssen?
- Befinden wir uns in einem konfrontativen oder kooperativen Umfeld?
Echte Probleme auf der operativen bzw. taktischen Ebene können massive Auswirkungen auf die strategische Sicht haben: Plötzlich fällt z. B. die Leistungsfähigkeit eines starken (Werbe-)Kanals im Unternehmen weg und kommt auch nicht wieder. Das kann ein Erdbeben bis tief in die strategische Ausrichtung von Unternehmen haben.
Wenn Du eigene strategische Fragestellungen hast, die Dir geholfen haben, die Wechselwirkungen mit neuen Problem zu strukturieren: Schick sie mir gerne per E-Mail. Ich ergänze sie sehr gern, inkl. Deinem Namen + Link, versteht sich.
Die narrative Sicht
Im Rahmen der narrativen Perspektive achte ich auf die Geschichten, Bilder und Erzählweisen, mit denen Menschen sich selbst, andere und ihre Situation beschreiben. Und vor allem: Welche Wirkung diese Narrative entfalten.
Viele echte Probleme sind keine reinen Sachprobleme, sondern Missverständnisse durch unterschiedliche Deutungen. Die Geschichte, die sich jemand erzählt, (z. B. "Wir wurden übergangen", "Das war schon immer so", "Ich darf mich da nicht einmischen") hat oft mehr Einfluss auf Verhalten und Entscheidung als Zahlen oder Fakten. Wer das nicht glaubt, der möge seinen Blick auf die aktuelle Deutschland- oder US-Politik werfen ...
Die narrative Sichtweise ist besonders dann hilfreich, wenn sich etwas "verhakt" oder festgefahren anfühlt. Oder wenn Menschen sehr unterschiedliche Beschreibungen desselben Sachverhalts verwenden. Ich schaue dann gezielt auf Muster in der Sprache, in der Bildwelt, in den Begriffen (und kombiniere diese in aufwändigeren Setups mit den jeweiligen Werte-Mustern der Menschen, das ist oft besonders aufschlussreich).
Hier ein paar narrative Fragen aus meinen Ebenen-Modellen, die sich in solchen Situationen bewährt haben:
- Welche Geschichte wird über das Problem erzählt? Wer ist darin Held, Opfer, Schuldiger, Retter? Wer erzählt welche Version?
- Welche Begriffe werden regelmäßig verwendet und was drücken sie eigentlich aus? Was verstehen andere unter diesen Begriffen?
- Welche Bilder oder Metaphern tauchen auf? (z. B. Kampf, Mangel, Aufbruch, Labyrinth ...)
- Gibt es unausgesprochene Narrative, die das Verhalten still mitsteuern?
- Wem gehört die Geschichte? Wer erzählt sie wie und mit welchem Zweck? Findet eine Ritualisierung statt (z. B. bei neuen Mitarbeitenden?)
- Welche alternativen Narrative wären denkbar und was würde sich dadurch ändern? Wer könnte diese erzählen oder müssen diese "eingeschleust" werden?
- Wie könnte ein Reframing aussehen, das Handlungsfähigkeit stärkt, statt sie zu blockieren?
- Was wird weggelassen oder ignoriert? (Die blinden Flecken im Narrativ ...)
- Welche Übergänge in der Erzählung fehlen? Wie wäre es möglich, eine neue Geschichte zu beginnen?
- Wie stark ist das aktuelle Narrativ verknüpft mit Identität und wie stabil ist diese Verknüpfung?
Ich mag diese Perspektive, weil ihre oft immense Macht subtil wirkt. Und ich begegne der Sache mit einem großen Respekt. Wer beginnt, seine Geschichte zu verändern, verändert oft alles: Blickwinkel, Freiheitsgrade, Handlungsspielräume, Beziehung zum Problem. Aber: Nicht jeder will oder kann seine Geschichte verändern. Und dennoch reicht manchmal schon ein einzelnes anderes Bild und plötzlich wird etwas möglich, das vorher nicht denkbar war.
Falls Du gute narrative Fragen, Formulierungen oder Beispiele kennst: Bitte schick sie mir gerne per E-Mail. Ich ergänze diese Liste hier dann mit Namensnennung und Link, wenn Du möchtest.
Macht macht Macht.
Im Rahmen der machtbezogenen Perspektive schaue ich auf Einfluss, Positionierung, Interessen, Abhängigkeiten. Wer entscheidet was? Wer beeinflusst wen? Wer zieht welche Fäden und warum?
Diese Sicht hilft mir, Situationen besser zu verstehen, in denen z. B. Projekte auf der Sachebene gut geplant sind, aber trotzdem nicht durchkommen. Oder wenn jemand sagt "Ich darf das nicht entscheiden", obwohl formell eigentlich alles dafür spricht.
Besonders spannend wird es dort, wo formale Macht (also Titel, Funktionen, Hierarchien) nicht mit faktischer Wirksamkeit übereinstimmt. Oder wo ganze Systeme auf stillen Abhängigkeiten basieren (Stichwort: Vorderbühne/Hinterbühne in Organisationen). Dann lohnt es sich, genau hinzusehen: Wer hat welches Interesse an welchem Status quo?
Einige Fragen aus meinen Ebenen-Modellen, die ich für solche Beobachtungen nutze:
- Wer sind die einflussreichsten Akteure in dieser Situation (sichtbar und unsichtbar)?
- Wer profitiert davon, wenn alles bleibt wie es ist und wer nicht, wer leidet? Auch: Für wen ist es gut, wenn wer leidet?
- Welche formalen Machtstrukturen existieren und wie unterscheiden sie sich von den informellen? Wer ist hilfreich bei der Erkennung?
- Gibt es stille Abhängigkeiten oder unausgesprochene "Deals", die bestimmte Handlungen verhindern? (Tipp: Achtsam werden, wenn strafrechtliche Aspekte im Raum sind: Korruption, Erpressung, Unterschlagung ...)
- Welche Beziehungen (persönlich, institutionell, emotional) wirken im Hintergrund?
- Welche Interessen sind im Spiel (explizit oder implizit) und wie offen wird über sie gesprochen?
- Wo zeigt sich Widerstand und wie schnell tritt er auf? (Tipp: Latenzzeiten analysieren!)
- Wie ist der Zugang zu Ressourcen verteilt (z. B. Zeit, Geld, Wissen, Netzwerke)?
- Wer wird in Entscheidungsprozesse einbezogen und wer nicht und wie wird das begründet?
- Welche impliziten Regeln sichern bestehende Machtverhältnisse und wer profitiert davon langfristig?
Die machtbezogene Sicht ist oft unbequem. Aber ohne sie bleiben viele scheinbar rationale Blockaden unerklärlich. Erst wenn ich beginne, das Spielfeld der Interessen und Einflussmechanismen zu kartieren, werden komplexe Probleme strategisch bearbeitbar. Ich war am überlegen, ob ich diese Perspektive überhaupt hier hineinnehme: Es bräuchte dazu noch mehr begleitende Worte. Wenn man ein echtes Problem in Unternehmen zu beobachten versucht und sich ungünstige Machtsituationen beobachtet fühlen, kann das unüberschaubare Auswirkungen haben. (Notiz an mich: Mit Konrad reflektieren.)
Wenn Du aus der Praxis noch Beobachtungen hast, die zu dieser Perspektive passen: Ich freue mich sehr über eine E-Mail. Gerne ergänze ich Deine Impulse hier – natürlich mit Namen und Link.
Die ökologische Sicht
Klartext: Die allermeisten Unternehmen interessiert diese Perspektive nicht. Ich möchte eine Hypothese in den Raum stellen: Unternehmen werden es sich in den nächsten zwei bis drei Dekaden gar nicht mehr leisten können, diese Perspektive NICHT fein differenziert auf strategischer, taktischer und operativer Ebene integriert zu haben. Das Zeitalter des "Cash-and-Run" ist vermutlich mit dem fortschreitenden Klimawandel endgültig vorüber. Die gute Nachricht: In diesem Thema stecken ungeahnte positive Chancen.
Bei der ökologischen Perspektive betrachte ich nicht nur die beteiligten Menschen oder Strukturen, sondern auch die Wechselwirkungen mit dem Umfeld. Es geht mir um Ressourcen, Kreisläufe, Belastungsgrenzen, Resilienz. Und um die Frage, was wir mit unserem Handeln anrichten, fördern oder zerstören, bewusst oder meist leider unbewusst.
Als Beispiel ein aktueller Fall: Auf LinkedIn agiert sich gerade ein KI-Hype aus, bei dem sich Menschen als Action-Figur in einer Plastik-Blisterbox abbilden. Eine nette, harmlose Spielerei, die nur ein paar Watt Energie kostet. Menschen reagieren beleidigt, wenn man sie auf die Konsequenzen ihres Handelns aufmerksam macht: Es sind leider bei einer Million Bilder viele Megawatt Energie und viele Gigabyte Speicherplatz, die allesamt für ein paar Sekunden Erregung verbraucht bzw. allokiert wurden. Aussage von Sam Altman, OpenAI, sinngemäß: "Unsere GPUs schmelzen!". Ein harmloser Alltags-Gag mit enormen, langfristigen Konsequenzen.
Ich nutze diese Sicht vor allem dann, wenn ein Problem zwar lokal erscheint, aber Auswirkungen auf größere Zusammenhänge hat. Oder wenn die Entscheidungen von heute Rückwirkungen auf die Bedingungen von morgen erzeugen, die bisher niemand mitgedacht hat.
Ökologie ist für mich nicht nur Natur, sondern Systemumwelt. Also auch Märkte, soziale Kontexte, technologische Umgebungen; wir sind Menschen = ein Stück Natur. Ich frage mich dann, wie sich etwas in das größere Ganze einbettet oder an welchen Stellen langfristig Kollateralschäden entstehen könnten.
Hier ein paar Fragen aus meinen Ebenen-Modellen, die ich für diesen Blick nutze:
- Welche Ressourcen (z. B. Energie, Aufmerksamkeit, Vertrauen, Geld, Boden) werden verbraucht oder regeneriert?
- Gibt es Kreisläufe oder Rückführungen oder wird nur linear genommen und verbraucht?
- Welche Grenzen des Systems (z. B. Belastungsgrenzen, Verfügbarkeiten, Tragfähigkeiten) werden erreicht oder überschritten?
- Was wird durch die Lösung dieses echten Problems möglich gemacht und was wird dabei zerstört oder geschwächt?
- Welche Folgewirkungen auf andere Kontexte oder Systeme könnten auftreten, wenn wir so weiterarbeiten?
- In welchem ökologischen Zusammenhang steht das Problem überhaupt, wo beginnt es, wo endet es?
- Was passiert, wenn sich das System nicht mehr selbst regulieren kann?
- Wie hoch ist der Reparaturaufwand, wenn wir jetzt nicht agieren?
- Was würde sich verändern, wenn wir Regeneration oder Antifragilität als Ziel definieren würden?
- Welche Potenziale für Balance oder Kompensation existieren bereits und wie können wir sie stärken?
Die Ökologie ist wahrscheinlich neben Ethik und Macht die unbequemste Perspektive für die meisten Unternehmen. Ich finde diesen Blick besonders hilfreich, wenn kurzfristige Problem-Lösungen langfristige neue echte Probleme erzeugen. Oder wenn sich etwas scheinbar "von selbst erledigt", aber dafür an anderer Stelle das System kippt. Die ökologische Perspektive zwingt mich dazu, größer zu denken und komplexe Wechselwirkungen mitzudenken auch wenn sie unbequem sind. Das bedeutet ja nicht, dass man in den superheiligen Moral-Trip verfällt. Es geht darum, Auswirkungen und Konsequenzen nicht abzulehnen, abzustreiten oder zu vermeiden, sondern diese zumindest festzustellen, zu beschreiben und anzuerkennen.
Wenn Du gute ökologische Fragen, Konzepte oder Fallbeispiele hast: Schick sie mir gerne per E-Mail. Ich ergänze sie mit Link + Name!
Die reflexive Sicht
Das hier ist manchmal die unbequemste Perspektive. Und manchmal fühlt es sich auch wie ein Kratzen an, das eine juckende Stelle besänftigt.
Bei der reflexiven Perspektive richte ich den Blick nicht nach außen, sondern nach innen. Ich frage mich: Was ist mein Anteil? Welche Haltung bringe ich mit? Und inwiefern bin ich Teil der Dynamik, die ich gerade beobachte?
Diese Sichtweise ist oft unbequem: Manchmal nicht nur geistig, sondern auch seelisch und sehr oft auch körperlich. Dann spüre ich z. B. wie ich vor etwas Angst habe. Oder müde werde, weil ich die Angst vermeide. Oder beschämt bin, weil ich mich nicht gut genug fühle.
So unangenehm sie ist, die reflexive Sicht hilft mir, die Beschaffenheit, Granularität, Feinheit meiner Wahrnehmung zu überprüfen, die Angemessenheit meiner Impulse zu hinterfragen und die Passung meiner Methoden zur Situation zu klären.
Ich nutze diese Perspektive vor allem dann, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu schnell mit Bewertungen bin. Oder wenn ich spüre, dass ich mich in bestimmte Situationen zu sehr "hineinziehen" lasse. Oder auch, wenn sich Dinge wiederholen und ich ahne, dass das etwas mit mir zu tun haben könnte.
Ein guter Indikator ist für mich, wenn der Auftrag eine Beschreibung gewesen wäre, ich jedoch plötzlich bei Erklärungen, Deutungen, Bewertungen gelandet bin ... das ist dann eine regelrechte Aufforderung für die Reflexion.
Hier einige Fragen aus meinen Ebenen-Modellen, die mich bei dieser Selbstprüfung unterstützen:
- Welche Annahmen bringe ich in diese Situation mit und auf welchen Erfahrungen beruhen sie? (Tipp: Mir hilft es, mich vor bestimmten Gesprächen "leer" zu machen. Dabei ermuntere ich mein Gehirn, so faul wie nur möglich zu werden, damit ich mit einem Null-Wissen in die Situation gehen kann. Ich muss mir alles erklären lassen und gut zuhören.)
- Welche Hypothesen verfolge ich gerade und wie überprüfe ich, ob sie überhaupt relevant oder wahr sind?
- Wie wirkt mein eigenes Wertesystem auf meine Sichtweise und was davon ist verhandelbar?
- Gibt es blinde Flecken in meinem Vorgehen oder in meiner Wahrnehmung, die ich regelmäßig übersehe?
- Woran merke ich, dass ich gerade überidentifiziert bin mit einem Thema oder einer Rolle?
- Welche Muster in meiner Arbeit oder Kommunikation wiederholen sich häufiger als mir lieb ist?
- Wie kann ich zwischen Intuition und Projektion unterscheiden? Und wann sollte ich lieber nachfragen?
- Welches Feedback habe ich in vergleichbaren Situationen erhalten und wie bin ich damit umgegangen? (Beispiel-Frage für das Feedback: "Bei welchen Themen hättest Du Dir eine andere Vorgehensweise gewünscht?"
- Wo will ich gerade recht behalten statt wirklich zu verstehen? (Tipp: Impulskontrolle, it's a thing ...)
Diese Übung ist für mich persönlich jedes Mal herausfordernd und heilsam zugleich. Sie hilft mir, meinen eigenen Denkraum zu erweitern. Und sie zwingt mich, in Bewegung zu bleiben. Nichts als gegeben hinzunehmen. Und vor allem nicht mich selbst.
Und was in diesem Kontext unbezahlbar wertvoll ist: Liebe Menschen, die sich die Zeit nehmen und den Raum erschaffen und halten, in dem so eine Reflexion stattfinden kann.
Falls Du gute reflexive Fragen oder eigene Beobachtungen hast, die Du teilen möchtest: Schreib mir gerne eine E-Mail. Ich liebe Lernen!
Und was ist jetzt die Lösung?
Komplexe Situationen sind weniger Gleichungen, sondern eher wie miteinander verbundene, erregbare Spannungsfelder. Es gibt keine finale Antworten, sondern Hypothesen, Irritationen, Wirkungen, Nebenwirkungen, neue Probleme. Und genau deshalb arbeite ich mit unterschiedlichen Perspektiven, um den Raum für Fühlen, Denken, Fühl-Denken, Wahrnehmung, Beobachtung und Entscheidung zu erweitern.
Was also tun, statt nach "der Lösung" zu fragen?
- Beobachten, ohne vorschnelle Bewertung, Deutung oder Erklärung.
- (Andere) Fragen stellen, zum Beispiel aus den Perspektiven oben, um zu verstehen, zu be-greifen.
- Die Perspektive wechseln: Systemisch, strategisch, psychologisch, ökologisch, narrativ ...
- Mit Hypothesen arbeiten und nicht mit Vermutungen.
- "Den Raum spüren" (das setzt einen Zugang zu den eigenen Gefühlen voraus): Nimm die Wahrnehmung zu Deiner Beobachtung hinzu. Ist es deckungsgleich, ergänzt es sich oder ist es gar ein Widerspruch?
- Kleine Experimente, Prototypen starten: Impulse, Störungen, Irritationen, die Rückmeldung erzeugen. Beobachte und beschreibe, ohne zu bewerten, zu deuten oder zu erklären.
- Unklarheit und Komplexität aushalten ohne sofort handeln zu müssen. (Tipp: Ein repetitiver, starker Handlungs-Impuls kann ein interessanter Indikator sein.)
- Erkennen, was Du nicht beeinflussen kannst und was sehr wohl.
Ich weiß: Das ist keine einfache Antwort. Wir haben es ja auch mit keinem einfachen Problem zu tun. Genauer betrachtet sollte die Komplexität unseres Denkens ein wenig umfassender ausgeprägt sein, als das System, welches wir beobachten. Oft hilft es, mehr Gehirne = mehr Menschen hinzuzufügen, die bei den Beobachtungen, Beschreibungen etc. mitwirken.
"Was ist die Lösung?"
Ich hoffe, ich konnte einen ersten Einblick dazu geben, weshalb ich die Frage "Was ist die Lösung?" bei der Bearbeitung echter Probleme als "unangemessene Trivialisierung von Komplexität" beschreibe.
Danke, dass Du bis hierher gelesen hast. Viele der Sätze/ Formulierungen/ Fragen kommen Dir vielleicht bekannt vor, sie sind seit langer Zeit Teil meiner täglichen Arbeit und ich benutze sie u.a. öfters in LinkedIn-Beiträgen. :-D
Ich hoffe, Du konntest für Dich einige Impulse aus diesem Beitrag gewinnen.
Liebe Grüße und bis bald, Karl
P.S.: Zu diesem Thema gibt es bald ein Seminar mit dem Titel "Tiefes Denken". In dem Seminar geht es darum, grundsätzlich die Fähigkeit auszubilden, systematisch neue Perspektiven und Dimensionalitäten im Denken zu erschließen. Das Ziel ist es, Sachverhalte intensiver, feiner und systemischer wahrzunehmen und zu beschreiben.
